Datenschutzerklärung
1) Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen
1.1 Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse. Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten bei Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.
1.2 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf dieser Website im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist Damian Minichowski, Kronsbruch 44, 21423 Winsen (Luhe), Deutschland, Tel.: 0160 / 7918915, E-Mail: FurorGermanicus@gmail.com. Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.
1.3 Diese Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung personenbezogene Daten und anderer vertraulicher Inhalte (z.B. Bestellungen oder Anfragen an den Verantwortlichen) eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Sie können eine verschlüsselte Verbindung an der Zeichenfolge „https://“ und dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile erkennen.
2) Datenerfassung beim Besuch unserer Website
Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (sog. „Server-Logfiles“). Wenn Sie unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen:
- Unsere besuchte Website
- Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
- Menge der gesendeten Daten in Byte
- Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
- Verwendeter Browser
- Verwendetes Betriebssystem
- Verwendete IP-Adresse (ggf.: in anonymisierter Form)
Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website. Eine Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt. Wir behalten uns allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.
3) Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen (Cookies von Drittanbietern), Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Werden Cookies gesetzt, erheben und verarbeiten diese im individuellen Umfang bestimmte Nutzerinformationen wie Browser- und Standortdaten sowie IP-Adresswerte. Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann.
Teilweise dienen die Cookies dazu, durch Speicherung von Einstellungen den Bestellprozess zu vereinfachen (z.B. Merken des Inhalts eines virtuellen Warenkorbs für einen späteren Besuch auf der Website). Sofern durch einzelne von uns implementierte Cookies auch personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO entweder zur Durchführung des Vertrages oder gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der bestmöglichen Funktionalität der Website sowie einer kundenfreundlichen und effektiven Ausgestaltung des Seitenbesuchs.
Wir arbeiten unter Umständen mit Werbepartnern zusammen, die uns helfen, unser Internetangebot für Sie interessanter zu gestalten. Zu diesem Zweck werden für diesen Fall bei Ihrem Besuch unserer Website auch Cookies von Partnerunternehmen auf Ihrer Festplatte gespeichert (Cookies von Drittanbietern). Wenn wir mit vorbenannten Werbepartnern zusammenarbeiten, werden Sie über den Einsatz derartiger Cookies und den Umfang der jeweils erhobenen Informationen innerhalb der nachstehenden Absätze individuell und gesondert informiert.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Browser so einstellen können, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen können. Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtannahme von Cookies die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein kann.
4) Kontaktaufnahme
Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
5) Datenverarbeitung bei Eröffnung eines Kundenkontos und zur Vertragsabwicklung
Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO werden personenbezogene Daten weiterhin erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese zur Durchführung eines Vertrages oder bei der Eröffnung eines Kundenkontos mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Eine Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann durch eine Nachricht an die o.g. Adresse des Verantwortlichen erfolgen. Wir speichern und verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder eine gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbehalten wurde, über die wir Sie nachstehend entsprechend informieren.
6) Kommentarfunktion
Im Rahmen der Kommentarfunktion auf dieser Website werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars und der von Ihnen gewählte Kommentatorenname gespeichert und auf der Website veröffentlicht. Ferner wird Ihre IP-Adresse mitprotokolliert und gespeichert. Diese Speicherung der IP-Adresse erfolgt aus Sicherheitsgründen und für den Fall, dass die betroffene Person durch einen abgegebenen Kommentar die Rechte Dritter verletzt oder rechtswidrige Inhalte postet. Ihre E-Mailadresse benötigen wir, um mit Ihnen in Kontakt zu treten, falls ein Dritter Ihren veröffentlichten Inhalt als rechtswidrig beanstanden sollte. Rechtsgrundlagen für die Speicherung Ihrer Daten sind die Art. 6 Abs. 1 lit.b und f DSGVO. Wir behalten uns vor, Kommentare zu löschen, wenn sie von Dritten als rechtswidrig beanstandet werden.
Die Nachfolgekommentare können von Ihnen als Nutzer abonniert werden. Sie erhalten hierzu eine Bestätigungs-E-Mail, damit sichergestellt werden kann, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind (Double-Opt-In-Verfahren). Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Falle der Abonnierung von Kommentaren ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können laufende Kommentarabonnements jederzeit mit Wirkung für die Zukunft abbestellen, nähere Informationen zur Abbestellmöglichkeit entnehmen Sie bitte der Bestätigungs-E-Mail.
7) Nutzung Ihrer Daten zur Direktwerbung
7.1 Anmeldung zu unserem E-Mail-Newsletter
Wenn Sie sich zu unserem E-Mail Newsletter anmelden, übersenden wir Ihnen regelmäßig Informationen zu unseren Angeboten. Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mailadresse. Die Angabe weiterer Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sog. Double Opt-in Verfahren. Dies bedeutet, dass wir Ihnen erst dann einen E-Mail Newsletter übermitteln werden, wenn Sie uns ausdrücklich bestätigt haben, dass Sie in den Empfang von Newsletter einwilligen. Wir schicken Ihnen dann eine Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie gebeten werden durch Anklicken eines entsprechenden Links zu bestätigen, dass Sie künftig den Newsletter erhalten wollen.
Mit der Aktivierung des Bestätigungslinks erteilen Sie uns Ihre Einwilligung für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre vom Internet Service-Provider (ISP) eingetragene IP-Adresse sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung, um einen möglichen Missbrauch Ihrer E-Mail- Adresse zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können. Die von uns bei der Anmeldung zum Newsletter erhobenen Daten werden ausschließlich für Zwecke der werblichen Ansprache im Wege des Newsletters benutzt. Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter oder durch entsprechende Nachricht an den eingangs genannten Verantwortlichen abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich in unserem Newsletter-Verteiler gelöscht, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüberhinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.
7.2 Newsletterversand via ActiveCampaign
Der Versand unserer E-Mail-Newsletter erfolgt über den technischen DienstleisterActiveCampaign, LLC, 150 N. Michigan Ave Suite 1230, Chicago, IL, US, USA („ActiveCampaign“), an den wir Ihre bei der Newsletteranmeldung bereitgestellten Daten weitergeben.
Diese Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und dient unserem berechtigten Interesse an der Verwendung eines werbewirksamen, sicheren und nutzerfreundlichen Newslettersystems. Die von Ihnen zwecks Newsletterbezugs eingegebenen Daten (z.B. E-Mail-Adresse) werden auf den Servern von ActiveCampaign in den USA gespeichert. ActiveCampaign verwendet diese Informationen zum Versand und zur statistischen Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. Für die Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sog. Web-Beacons bzw. Trackings-Pixel, die Ein-Pixel-Bilddateiendarstellen, die auf unserer Website gespeichert sind. So kann festgestellt werden, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. angeklickt wurden.
Mit Hilfe des sog. Conversion-Trackings kann außerdem analysiert werden, ob nach Anklicken des Links im Newsletter eine vorab definierte Aktion (z.B. Kauf eines Produkts auf unserer Website) erfolgt ist. Außerdem werden technische Informationen erfasst (z.B. Zeitpunktdes Abrufs, IP-Adresse, Browsertyp und Betriebssystem). Die Daten werden ausschließlich pseudonymisiert erhoben und werden nicht mir Ihren weiteren persönlichen Daten verknüpft, eine direkte Personenbeziehbarkeit wird ausgeschlossen.
Diese Daten dienen ausschließlich der statistischen Analyse von Newsletterkampagnen. Die Ergebnisse dieser Analysen können genutzt werden, um künftige Newsletter besseran die Interessen der Empfänger anzupassen. Wenn Sie der Datenanalyse zu statistischen Auswertungszwecken widersprechenmöchten, müssen Sie den Newsletterbezug abbestellen.
Wir haben mit ActiveCampaign einen Auftragsverarbeitungsvertrag („Data ProcessingAgreement“) abgeschlossen, mit dem wir ActiveCampaign verpflichten, die Daten unserer Kunden zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzugeben.
Die Datenschutzerklärung von ActiveCampaign können Sie hier einsehen: https://www.activecampaign.com/privacy-policy
7.3 Newsletter-Versand via MailChimp
Der Versand unserer E-Mail-Newsletter erfolgt über den technischen Dienstleister The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), an den wir Ihre bei der Newsletteranmeldung bereitgestellten Daten weitergeben. Diese Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und dient unserem berechtigten Interesse an der Verwendung eines werbewirksamen, sicheren und nutzerfreundlichen Newslettersystems. Bitte beachten Sie, dass Ihre Daten in der Regel an einen Server von MailChimp in den USA übertragen und dort gespeichert werden.
MailChimp verwendet diese Informationen zum Versand der Newsletter in unserem Auftrag. MailChimp nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger nicht, um diese selbst anzuschreiben oder sie an Dritte weiterzugeben.
Zum Schutz Ihrer Daten in den USA haben wir mit MailChimp einen Datenverarbeitungsauftrag („Data-Processing-Agreement“) auf Basis der Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission abgeschlossen, um die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an MailChimp zu ermöglichen. Dieser Datenverarbeitungsvertrag kann bei Interesse unter nachstehender Internetadresse eingesehen werden: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
Die Datenschutzbestimmungen von MailChimp können Sie hier einsehen: https://mailchimp.com/legal/privacy/
8) Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung
8.1 Zur Abwicklung Ihrer Bestellung arbeiten wir mit dem / den nachstehenden Dienstleistern zusammen, die uns ganz oder teilweise bei der Durchführung geschlossener Verträge unterstützen. An diese Dienstleister werden nach Maßgabe der folgenden Informationen gewisse personenbezogene Daten übermittelt.
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir hierüber nachstehend explizit. Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
8.2 Weitergabe personenbezogener Daten an Versanddienstleister
- DHL
Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), so geben wir Ihre E-Mail-Adresse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO vor der Zustellung der Ware zum Zwecke der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an DHL weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse an DHL weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit DHL bzw. die Lieferankündigung nicht möglich.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister DHL widerrufen werden.
8.3 Verwendung von Paymentdienstleistern (Zahlungsdienstleister)
- Paypal
Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten - "Kauf auf Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nachfolgend "PayPal"), weiter. Die Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und nur insoweit, als dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist.
PayPal behält sich für die Zahlungsmethoden Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten - "Kauf auf Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. Hierfür werden Ihre Zahlungsdaten gegebenenfalls gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses von PayPal an der Feststellung Ihrer Zahlungsfähigkeit an Auskunfteien weitergegeben. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zwecke der Entscheidung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte).
Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein. Weitere datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den verwendeten Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an PayPal widersprechen. Jedoch bleibt PayPal ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.
- Stripe
Wenn Sie sich für eine Zahlungsart des Paymentdienstleisters Stripe entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Paymentdienstleister Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irland, an den wir Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung (Name, Anschrift, Kontonummer, Bankleitzahl, evtl. Kreditkartennummer, Rechnungsbetrag, Währung und Transaktionsnummer) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO weitergeben. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung mit dem Payment-Dienstleister Stripe Payments Europe Ltd. und nur insoweit, als sie hierfür erforderlich ist. Nähere Informationen zum Datenschutz von Stripe finden Sie unter der URL https://stripe.com/de/terms
9) Verwendung von Sozialen Medien: Social Plugins
9.1 Facebook als Standard-Plugin
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes Facebook verwendet, das von der Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook") betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem Zusatz "Soziales Plug-in von Facebook" bzw. "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook Plugins und deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Profil besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Profil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den "Gefällt mir"-Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird diese Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem Facebook- Profil veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt.
Die beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis der berechtigten Interessen von Facebook an der Einblendung personalisierter Werbung, um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und zur bedarfsgerechten Ausgestaltung des Dienstes.
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unsere Website gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Facebook-Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. Sie können das Laden der Facebook Plugins und damit den oben beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge auch mit Add-Ons für Ihren Browser für die Zukunft widersprechen, z.B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).
Facebook Inc. mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php
9.2 Facebook-Plugins mit Shariff-Lösung
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes Facebook verwendet, das von der Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook") betrieben wird.
Um den Schutz Ihrer Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind diese Schaltflächen nicht uneingeschränkt als Plugins, sondern lediglich unter Verwendung eines HTML-Links in die Seite eingebunden. Durch diese Art der Einbindung wird gewährleistet, dass beim Aufruf einer Seite unserer Website, die solche Schaltflächen enthält, noch keine Verbindung mit den Servern von Facebook hergestellt wird. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, öffnet sich ein neues Browserfenster und ruft die Seite von Facebook auf, auf der Sie (ggf. nach Eingabe Ihrer Login-Daten) mit den dortigen Plugins interagieren können.
Facebook Inc. mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
9.3 Google+ als Standard-Plugin
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes Google+ verwendet, das von der Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") betrieben wird. Die Plugins sind z. B. an Buttons mit dem Zeichen "+1" auf weißem oder farbigem Hintergrund erkennbar. Eine Übersicht über die Google Plugins und deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.google.com/+/plugins
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Google her. Der Inhalt des Plugins wird von Google direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung erhält Google die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil bei Google+ besitzen oder gerade nicht bei Google+ eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Google in die USA übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei Google+ eingeloggt, kann Google den Besuch unserer Website Ihrem Google+ Profil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den "+1"-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Google übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Google+ veröffentlicht und dort Ihren Kontakten angezeigt.
Die beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO auf Basis der berechtigten Interessen von Google an der Einblendung personalisierter Werbung,um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und zur bedarfsgerechten Ausgestaltung des Dienstes .
Wenn Sie nicht möchten, dass Google die über unsere Website gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Profil auf Google+ zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Google+ ausloggen.
Sie können das Laden der Google+ Plugins und damit den oben beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge auch mit Add-Ons für Ihren Browser für die Zukunft widersprechen, z. B. mit dem Skript-Blocker "NoScript" (http://noscript.net/).
Google LLC mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
9.4 Instagram als Standard-Plugin
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des Online-Dienstes Instagram verwendet, das von der Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Instagram-Logo beispielsweise in Form einer „Instagram-Kamera“ gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Instagram Plugins und deren Aussehen finden Sie hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Instagram her. Der Inhalt des Plugins wird von Instagram direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Instagram die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Instagram-Profil besitzen oder gerade nicht bei Instagram eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Instagram in die USA übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei Instagram eingeloggt, kann Instagram den Besuch unserer Website Ihrem Instagram-Account unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Instagram Kamera“-Button betätigen, wird diese Information ebenfalls direkt an einen Server von Instagram übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem Instagram-Account veröffentlicht und dort Ihren Kontakten angezeigt.
Die beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis der berechtigten Interessen von Instagram an der Einblendung personalisierter Werbung, um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und zur bedarfsgerechten Ausgestaltung des Dienstes.
Wenn Sie nicht möchten, dass Instagram die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Instagram-Account zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Instagram ausloggen. Sie können das Laden der Instagram Plugins und damit den oben beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge auch mit Add-Ons für Ihren Browser für die Zukunft widersprechen, z.B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).
Instagram LLC. mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Instagram sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
9.5 Pinterest als Standard-Plugin
Auf den Seiten des Verkäufers werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes Pinterest verwendet, das von der Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA („Pinterest“) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Pinterest-Logo (z.B. „Pin it“-Button) gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Pinterest Plugins und deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/
Wenn Sie eine Seite des Verkäufers aufrufen die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest her. Das Plugin übermittelt hierbei sog. Protokolldaten an den Server von Pinterest in die USA. Diese Protokolldaten enthalten möglicherweise die IP-Adresse, die Adresse der besuchten Websites, die über Pinterest-Funktionen verfügen, Art und Einstellungen des Browsers, Datum und Zeitpunkt der Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Pin it“-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Pintererst übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem bei Pinterest veröffentlicht und dort auf Ihrem Pinterest-Account angezeigt.
Die beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO auf Basis der berechtigten Interessen von Pinterest an der Einblendung personalisierter Werbung, um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und zur bedarfsgerechten Ausgestaltung des Dienstes.
Wenn Sie es nicht wünschen, dass Pinterest Ihre Daten über unsere Website sammelt und diese unter Umständen mit Ihren Nutzerdaten bei Pinterest zusammenführt, sollten Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Pinterest abmelden.
Sie können das Laden der Pinterest-Plugins und damit den oben beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge auch mit Add-Ons für Ihren Browser für die Zukunft widersprechen, z.B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Pinterest sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
9.6 Pinterest-Plugin als Shariff-Lösung
Auf den Seiten des Verkäufers werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes Pinterest verwendet, das von der Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA („Pinterest“) betrieben wird.
Um den Schutz Ihrer Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind diese Schaltflächen nicht uneingeschränkt als Plugins, sondern lediglich unter Verwendung eines HTML-Links in die Seite eingebunden. Durch diese Art der Einbindung wird gewährleistet, dass beim Aufruf einer Seite unserer Website, die solche Schaltflächen enthält, noch keine Verbindung mit den Servern von Pinterest hergestellt wird. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, öffnet sich ein neues Browserfenster und ruft die Seite von Pinterest auf, auf der Sie (ggf. nach Eingabe Ihrer Login-Daten) mit den dortigen Plugins interagieren können.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Pinterest sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
9.7 Twitter als Standard-Plugin
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins ("Plugins") des Mikroblogging-Dienstes Twitter verwendet, der von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter") betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Twitter-Logo beispielsweise in Form eines blauen "Twitter- Vogels" gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Twitter Plugins und deren Aussehen finden Sie hier: https://about.twitter.com/de/resources/buttons
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Twitter her. Der Inhalt des Plugins wird von Twitter direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung erhält Twitter die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil bei Twitter besitzen oder gerade nicht bei Twitter eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Twitter in die USA übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei Twitter eingeloggt, kann Twitter den Besuch unserer Website Ihrem Twitter-Account unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den "Twittern"-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Twitter übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem Twitter-Account veröffentlicht und dort Ihren Kontakten angezeigt.
Die beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO auf Basis der berechtigten Interessen von Twitter an der Einblendung personalisierter Werbung, um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und zur bedarfsgerechten Ausgestaltung des Dienstes.
Wenn Sie Mitglied des sozialen Netzwerks von Twitter sind und das Sammeln von Daten über unsere Website sowie die Zusammenführung Ihrer Nutzerdaten mit den über Sie bei dem sozialen Netzwerk Twitter gespeicherten Daten begrenzen möchten, sollten Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Twitter abmelden.
Sie können das Laden der Twitter Plugins und damit den oben beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge auch mit Add-Ons für Ihren Browser für die Zukunft widersprechen, z.B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).
Twitter Inc. mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Twitter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter: https://twitter.com/privacy
10) Verwendung von Sozialen Medien: Videos
Verwendung von Youtube-Videos
Diese Website nutzt die Youtube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters „Youtube“, der zu der Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) gehört.
Hierbei wird der erweiterte Datenschutzmodus verwendet, der nach Anbieterangaben eine Speicherung von Nutzerinformationen erst bei Wiedergabe des/der Videos in Gang setzt. Wird die Wiedergabe eingebetteter Youtube-Videos gestartet, setzt der Anbieter „Youtube“ Cookies ein, um Informationen über das Nutzerverhalten zu sammeln. Hinweisen von „Youtube“ zufolge dienen diese unter anderem dazu, Videostatistiken zu erfassen, die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern und missbräuchliche Handlungsweisen zu unterbinden. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet, wenn Sie ein Video anklicken. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) als Nutzungsprofile und wertet diese aus. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO auf Basis der berechtigten Interessen von Google an der Einblendung personalisierter Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen.
Unabhängig von einer Wiedergabe der eingebetteten Videos wird bei jedem Aufruf dieser Website eine Verbindung zum Google-Netzwerk „DoubleClick“ aufgenommen, was ohne unseren Einfluss weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen kann.
Google LLC mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „YouTube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
11) Online-Marketing
11.1 DoubleClick by Google
Diese Webseite nutzt das Online Marketing Tool DoubleClick by Google des Betreibers Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").
DoubleClick setzt Cookies ein, um für die Nutzer relevante Anzeigen zu schalten, die Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine Cookie-ID erfasst Google, welche Anzeigen in welchem Browser geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach angezeigt werden. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis unseres berechtigten Interesses an der optimalen Vermarktung unserer Website gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Darüber hinaus kann DoubleClick mithilfe von Cookie-IDs sog. Conversions erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen haben. Das ist etwa der Fall, wenn ein Nutzer eine DoubleClick-Anzeige sieht und später mit demselben Browser die Website des Werbetreibenden aufruft und dort etwas kauft. Laut Google enthalten DoubleClick-Cookies keine personenbezogenen Informationen.
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von DoubleClick erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
Wenn Sie der Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren widersprechen möchten, können Sie Cookies für Conversion-Tracking deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain www.googleadservices.com blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen. Alternativ können Sie sich bei der Digital Advertising Alliance unter der Internetadresse www.aboutads.info über das Setzen von Cookies informieren und Einstellungen hierzu vornehmen. Schließlich können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
Google LLC mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von DoubleClick by Google: http://www.google.de/policies/privacy/
11.2 Google AdSense
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Webanzeigendienst der Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google AdSense verwendet sog. "DoubleClick DART Cookies" ("Cookies"). Dies sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Darüber hinaus verwendet Google AdSense zur Sammlung von Informationen auch sog. "Web-Beacons" (kleine unsichtbare Grafiken), durch deren Verwendung einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Website aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden können. Die durch das Cookie und/ oder Web-Beacon erzeugten Informationen (einschließlich Ihrer IP-Adresse) über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google benutzt die so erhaltenen Informationen, um eine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die AdSense-Anzeigen durchzuführen. Die im Rahmen von Google AdSense von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die von Google erhobenen Informationen werden unter Umständen an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist und/ oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Die beschriebene Verarbeitung von Daten erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zum Zwecke der zielgerichteten werblichen Ansprache des Nutzers durch werbende Dritte, deren Anzeigen basierend auf dem ausgewerteten Nutzerverhalten auf dieser Website angezeigt werden. Gleichsam dient die Verarbeitung unserem finanziellen Interesse an der Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials unseres Internetauftritts durch Einblendung von personalisierten Drittwerbeinhalten gegen Entgelt.
Google LLC mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von Google: http://www.google.de/policies/privacy/
Sie können Cookies für Anzeigenvorgaben dauerhaft deaktivieren, indem Sie diese durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern oder das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Bitte beachten Sie, dass bestimmte Funktionen dieser Website möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden können, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.
11.3 Verwendung von Affiliate-Programmen
- Amazon Partnerprogramm (AmazonPartnerNet)
Wir nehmen am Partnerprogramm "AmazonPartnerNet" der Amazon EU S.a.r.l., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (nachfolgend "Amazon") teil. In diesem Zusammenhang haben wir auf unserer Website Werbeanzeigen als Links platziert, die zu Angeboten auf verschiedenen Amazon-Websites führen. Amazon setzt Cookies ein, hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden, um die Herkunft von Bestellungen nachvollziehen zu können, die über solche Links generiert wurden. Dabei kann Amazon unter anderem erkennen, dass Sie den Partnerlink auf unserer Website angeklickt haben. Diese Informationen werden zur Zahlungsabwicklung zwischen uns und Amazon benötigt. Sofern die Informationen auch personenbezogen Daten enthalten, erfolgt die beschriebene Verarbeitung auf Grundlage unseres berechtigten finanziellen Interesses an der Abwicklung von Provisionszahlungen mit Amazon gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Amazon finden Sie in der Amazon.de-Datenschutzerklärung unter http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401
Wenn Sie die Auswertung des Nutzerverhaltens via Cookies blockieren möchten, können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Sie können die interessenbezogenen Anzeigen bei Amazon auch über den Link http://www.amazon.de/gp/dra/info deaktivieren.
- AWIN Performance Advertising Netzwerk
Wir nehmen am Performance Advertising Netzwerk der AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (nachfolgend "AWIN") teil. Im Rahmen seiner Tracking-Dienste speichert AWIN zur Dokumentation von Transaktionen (z.B. von Leads und Sales) Cookies auf Endgeräten von Nutzern, die Webseiten oder andere Onlineangebote seiner Kunden besuchen oder nutzen (z.B. für einen Newsletter registrieren oder eine Bestellung in einem Onlineshop aufgeben). Diese Cookies dienen allein dem Zweck einer korrekten Zuordnung des Erfolgs eines Werbemittels und der entsprechenden Abrechnung im Rahmen seines Netzwerks.
In einem Cookie wird lediglich die Information darüber platziert, wann von einem Endgerät ein bestimmtes Werbemittel angeklickt wurde. In den AWIN Tracking Cookies wird eine individuelle, jedoch nicht auf den einzelnen Nutzer zuordnungsfähige Ziffernfolge hinterlegt, mit der das Partnerprogramm eines Advertisers, der Publisher, der Zeitpunkt der Aktion des Nutzers (Click oder View) dokumentiert werden. Hierbei erhebt AWIN auch Informationen über das Endgerät, von dem eine Transaktion durchgeführt wird, z.B. das Betriebssystem und den aufrufenden Browser. Sofern die Informationen auch personenbezogen Daten enthalten, erfolgt die beschriebene Verarbeitung auf Grundlage unseres berechtigten finanziellen Interesses an der Abwicklung von Provisionszahlungen mit AWIN gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Falls Sie die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser nicht wünschen, können Sie dies durch die entsprechende Browsereinstellung erreichen. Sie können in Ihrem jeweiligen Browser das Speichern von Cookies unter Extras/Internetoptionen deaktivieren, auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald ein Cookie gesendet wird. Bitte beachten Sie aber, dass Sie in diesem Fall mit einer eingeschränkten Darstellung der Onlineangebote und einer eingeschränkten Benutzerführung rechnen müssen. Sie können Cookies auch jederzeit löschen. In diesem Fall werden die darin hinterlegten Informationen von Ihrem Endgerät entfernt.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch AWIN erhalten Sie in der Datenschutzerklärung des Unternehmens: https://www.awin.com/de/rechtliches
11.1 Facebook Pixel für die Erstellung von Custom Audiences
Innerhalb unseres Onlineangebotes wird das sog. "Facebook-Pixel" des sozialen Netzwerkes Facebook eingesetzt, welches von der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook“) betrieben wird.
Klickt ein Nutzer auf eine von uns geschaltete Werbeanzeige, die bei Facebook ausgespielt wird, wird der URL unserer verknüpften Seite durch Facebook Pixel ein Zusatz angefügt. Sofern unsere Seite über Pixel das Teilen von Daten mit Facebook erlaubt, wird dieser URL-Parameter in den Browser des Nutzers per Cookie eingeschrieben, welches unsere verknüpfte Seite selbst setzt. Dieses Cookie wird von Facebook Pixel sodann ausgelesen und ermöglicht eine Weiterleitung der Daten an Facebook.
Mit Hilfe des Facebook-Pixels ist es Facebook einerseits möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. "Facebook-Ads") zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, welche wir an Facebook übermitteln (sog. „Custom Audiences“). Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir ebenfalls sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. So können wir weiter die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auswerten, indem wir nachvollziehen, ob Nutzer nach dem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website weitergeleitet wurden (sog. „Conversion“).
Die erhobenen Daten sind für uns anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer. Allerdings werden die Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook- Datenverwendungsrichtlinie (https://www.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. Die Daten können Facebook sowie dessen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen.
Die mit dem Einsatz des Facebook Pixels einhergehenden Datenverarbeitungen erfolgen aufgrund unseres überwiegenden berechtigten Interesses an der Auswertung, der Optimierung und des wirtschaftlichen Betriebs unseres Online-Angebots sowie unserer Werbemaßnahmen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die durch Facebook erzeugten Informationen werden in der Regel an einen Server von Facebook übertragen und dort gespeichert, hierbei kann es auch zu einer Übermittlung an die Server der Facebook Inc. in den USA kommen. Facebook Inc. mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Um der Erfassung durch den Facebook-Pixel und der Verwendung Ihrer Daten zur Darstellung von Facebook-Ads insgesamt zu widersprechen, können Sie durch Klick auf den nachstehenden Link ein Opt-Out-Cookie setzen, welches das Facebook Pixel-Tracking deaktiviert:
Facebook-Pixel deaktivieren
Dieses Opt-Out-Cookie funktioniert nur in diesem Browser und nur für diese Domain. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie den obigen Link erneut anklicken.
12) Webanalysedienste
12.1 Jetpack (ehemals WordPress.com-Stats)
Dieses Angebot nutzt den Webanalysedienst Jetpack (vormals WordPress.com-Stats) betrieben von Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA, unter Einsatz der Trackingtechnologie von Quantcast Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA. Mit Hilfe von Jetpack werden auf Basis unseres berechtigten Interesses an der statistischen Analyse des Nutzerverhaltens zu Optimierungs- und Marketingzwecken gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO pseudonymisierte Besucherdaten gesammelt, ausgewertet und gespeichert. Aus diesen Daten können zum selben Zweck pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und ausgewertet werden. Jetpack verwendet sog. Cookies, also kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Diese Cookies dienen unter anderem dazu, den Browser wiederzuerkennen, und ermöglichen so eine genauere Ermittlung der Statistikdaten. Die IP-Adresse des Nutzers hat an den erhobenen Informationen teil, wird aber sofort nach der Erhebung und vor deren Speicherung pseudonymisiert, um eine Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich der pseudonymisierten IP-Adresse) werden zur Wahrung der oben genannten Interessen auf einen Server in den USA übertragen und dort gespeichert.
Automattic Inc. mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Um einer Datenerhebung und -speicherung Ihrer Besucherdaten für die Zukunft zu widersprechen, können Sie unter nachfolgendem Link ein Opt-Out-Cookie von Quantcast beziehen, welches bewirkt, dass zukünftig keine Besucherdaten Ihres Browsers bei Jetpack erhoben und gespeichert werden: http://www.quantcast.com/opt-out
Der Opt-Out-Cookie wird von Quantcast gesetzt.
13) Retargeting/ Remarketing/ Empfehlungswerbung
Facebook Custom Audience über das Pixel-Verfahren
Diese Website verwendet den “Facebook-Pixel” der Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Im Falle der Erteilung einer ausdrücklichen Einwilligung kann hierdurch das Verhalten von Nutzern nachverfolgt werden, nachdem diese eine Facebook-Werbeanzeige gesehen oder angeklickt haben. Dieses Verfahren dient dazu, die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auszuwerten und kann dazu beitragen, zukünftige Werbemaßnahmen zu optimieren.
Die erhobenen Daten sind für uns anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer. Allerdings werden die Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook- Datenverwendungsrichtlinie (https://www.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. Sie können Facebook sowie dessen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Es kann ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Diese Verarbeitungsvorgänge erfolgen ausschließlich bei Erteilung der ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Eine Einwilligung in den Einsatz des Facebook-Pixels darf nur von Nutzern, die älter als 13 Jahre alt sind, erklärt werden. Falls Sie jünger sind, bitten wir Sie, Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis zu fragen.
Facebook Inc. mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Um die Verwendung von Cookies auf Ihrem Computer zu deaktivieren, können Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass zukünftig keine Cookies mehr auf Ihrem Computer abgelegt werden können bzw. bereits abgelegte Cookies gelöscht werden. Das Abschalten sämtlicher Cookies kann jedoch dazu führen, dass einige Funktionen auf unseren Internetseiten nicht mehr ausgeführt werden können. Sie können der Verwendung von Cookies durch Drittanbieter wie z.B. Facebook auch auf folgender Website der Digital Advertising Alliance deaktivieren: http://www.aboutads.info/choices/
14) Tools und Sonstiges
14.1 Google Maps
Auf unserer Website verwenden wir Google Maps (API) von Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps ist ein Webdienst zur Darstellung von interaktiven (Land-)Karten, um geographische Informationen visuell darzustellen. Über die Nutzung dieses Dienstes wird Ihnen unser Standort angezeigt und eine etwaige Anfahrt erleichtert.
Bereits beim Aufrufen derjenigen Unterseiten, in die die Karte von Google Maps eingebunden ist, werden Informationen über Ihre Nutzung unserer Website (wie z.B. Ihre IP-Adresse) an Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) als Nutzungsprofile und wertet diese aus. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO auf Basis der berechtigten Interessen von Google an der Einblendung personalisierter Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.
Google LLC mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Wenn Sie mit der künftigen Übermittlung Ihrer Daten an Google im Rahmen der Nutzung von Google Maps nicht einverstanden sind, besteht auch die Möglichkeit, den Webdienst von Google Maps vollständig zu deaktivieren, indem Sie die Anwendung JavaScript in Ihrem Browser ausschalten. Google Maps und damit auch die Kartenanzeige auf dieser Internetseite kann dann nicht genutzt werden.
Die Nutzungsbedingungen von Google können Sie unter http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html einsehen, die zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Ausführliche Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Verwendung von Google Maps finden Sie auf der Internetseite von Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
14.2 Google Web Fonts
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fontsdie von der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,Irland („Google“) bereitgestellt werden.
Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browser-Cache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierbei kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der Google LLC. in den USA kommen. Auf diese Weise erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde.
Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt einberechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/
14.3 Wordfence
Zu Sicherheitszwecken verwendet diese Webseite das Plugin „Wordfence“, einen Dienstder Defiant Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (nachstehend„Wordfence“).
Das Plugin schützt die Website und die damit verbundene IT-Infrastrukturvor unberechtigten Drittzugriffen, Cyberangriffen sowie vor Viren und Malware. Wordfence erfasst die IP-Adressen von Nutzern sowie gegebenenfalls weitere Daten zu Ihrem Verhalten auf unserer Website (insbesondere aufgerufene URLs und Header-Informationen), um illegitime Seitenzugriffe und Gefahren zu erkennen und abzuwehren. Dabei wird die erfasste IP-Adresse mit einer Liste bekannter Angreiferverglichen. Wird die erfasste IP-Adresse als Sicherheitsrisiko erkannt, kann Wordfencediese automatische für den Seitenzugriff sperren.
Die so erhobenen Informationenwerden an einen Server der Defiant Inc. in den USA übertragen und dort gespeichert. Die beschriebenen Datenverarbeitungen erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unsere berechtigten Interessen am Schutz der Webseite vor schädlichen Cyber-Angriffen und an der Wahrung der Struktur- und Datenintegrität- und -sicherheit. Die Defiant Inc. beruft sich auf die Standarddatenschutzklauseln laut Art. 46 Satz 2 lit. cDSGVO als Rechtsgrundlage für die Übermittlung von Daten in die USA. Verfügen Seitenbesucher der Webseite über Login-Rechte, setzt Wordfence außerdem Cookies (= kleine Textdateien) auf dem jeweils verwendeten Endgerät des Besuchers. Mithilfe der Cookies können bestimmte Standort- und Geräteinformationen ausgelesen werden, die eine Einschätzung darüber ermöglichen, ob der Login-berechtigte Zugriff von einer legitimierten Person stammt.
Gleichzeitig können über die Cookies Zugriffsrechte evaluiert und über eine seiteninterne Firewall entsprechend der Berechtigungsstufe freigegeben werden. Schließlich dienen die Cookies dazu, irreguläre Zugriffe von Seitenadministratoren von neuen Geräten oder neuen Standorten aus zu registrieren und andere Administratoren hierüber zu benachrichtigen. Diese Cookies werden nur gesetzt, sofern ein Nutzer über Login-Rechte verfügt. Bei Seitenbesucher ohne Login-Befugnis setzt Wordfence keine Cookies.
Sofern über die Cookies personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs.1 lit f. DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interessesan der Verhinderung illegitimer Zugriffe auf die Seitenverwaltung und der Abwehr nicht autorisierter Administratorenzugriffe. Wir haben mit der Defiant Inc. einen Auftragsverarbeitungsvertrag (Data Processing Agreement) abgeschlossen, mit dem wir das Unternehmen verpflichten, die Daten von Seitenbesuchern zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Weitere Informationen zur Datennutzung der Defiant Inc. für Wordfence erhalten Sie inder Datenschutzerklärung von Wordfence unter https://www.wordfence.com/privacy-policy/
15) Rechte des Betroffenen
15.1 Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren:
- Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen;
- Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten;
- Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen;
- Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
- Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist;
- Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt;
- Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.
15.2 WIDERSPRUCHSRECHT
WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSENABWÄGUNG IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUFGRUND UNSERES ÜBERWIEGENDEN BERECHTIGTEN INTERESSES VERARBEITEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIESE VERARBEITUNG WIDERSPRUCH MIT WIRKUNG FÜR DIE ZUKUNFT EINZULEGEN.
MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN. EINE WEITERVERARBEITUNG BLEIBT ABER VORBEHALTEN, WENN WIR ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN KÖNNEN, DIE IHRE INTERESSEN, GRUNDRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN ÜBERWIEGEN, ODER WENN DIE VERARBEITUNG DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN DIENT.
WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN. SIE KÖNNEN DEN WIDERSPRUCH WIE OBEN BESCHRIEBEN AUSÜBEN.
MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN ZU DIREKTWERBEZWECKEN.
16) Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen Rechtsgrundlage, am Verarbeitungszweck und – sofern einschlägig –zusätzlich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen).
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene seine Einwilligung widerruft. Existieren gesetzliche Aufbewahrungsfristen für Daten, die im Rahmen rechtsgeschäftlicher bzw. rechtsgeschäftsähnlicher Verpflichtungen auf der Grundlagevon Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO verarbeitet werden, werden diese Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene sein Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO ausübt, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene sein Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO ausübt. Sofern sich aus den sonstigen Informationen dieser Erklärung über spezifische Verarbeitungssituationen nichts anderes ergibt, werden gespeicherte personenbezogene Daten im Übrigen dann gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder aufsonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind.









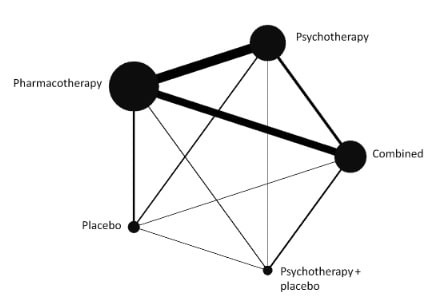
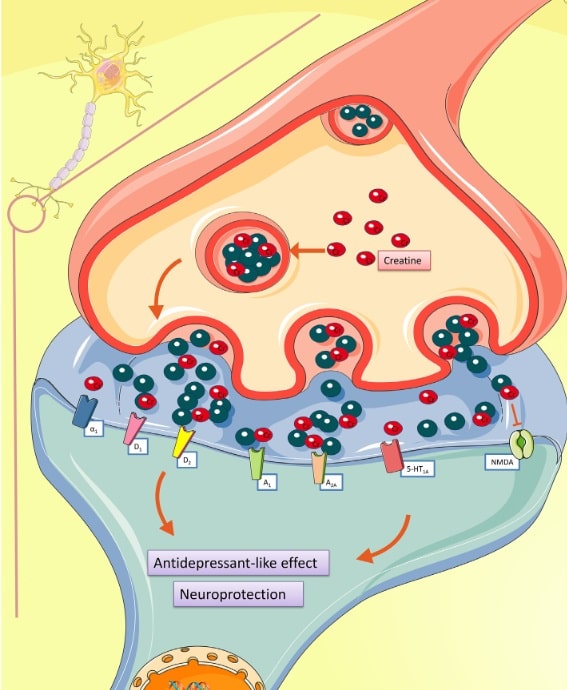






Neuste Kommentare